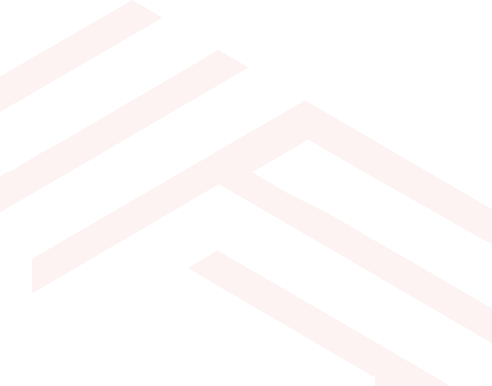Zunächst einmal: Die Antwort ist alles andere als einfach.
1.) Ein Blick in´s Gesetz erleichtert die Rechtsfindung?
Ich beginne mit einem Blick in die maßgeblichen Vorschriften. Man stellt dann allerdings schnell fest, dass man danach auch nicht wirklich schlauer ist:
„Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich“ (§ 38 Abs. 1 MVStättVO).
„Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn für die Sicherheit der Versammlungsstätte notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind“ (§ 38 Abs. 4 MVStättVO).
„Der Betreiber kann (…) übertragen, wenn dieser oder dessen beauftragter Veranstaltungsleiter mit der Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist“ (§ 38 Abs. 5 MVStättVO).
„Die Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik müssen mit den bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischen und sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vertraut sein und deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, während des Betriebs gewährleisten“ (§ 40 Abs. 1 MVStättVO).
„Die Anwesenheit (…) ist nicht erforderlich, wenn die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der bühnen-, studio– und beleuchtungstechnischen sowie der sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vom Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik überprüft wurden“ (§ 40 Abs. 5 Nr. 1 MVStättVO).
Wir sprechen hier von Vorschriften aus dem Sonderbaurecht, also nur aus einem einzigen Regelwerk, noch dazu „nur“ von einer Verordnung (und nicht von einem Gesetz). Der Betreiber, im Regelfall der Vermieter der Location, möchte von Berufs wegen seine Location gewinnbringend vermieten. Der Veranstalter, der eigentliche Veranlasser des Risikos „Veranstaltung“, will gewinnbringend seine Veranstaltungen durchführen. Warum soll der Betreiber über das Sonderbaurecht hinaus Verantwortung für eine fremde Veranstaltung (und deren Technik) übernehmen?
2.) Ein Blick auf die Rechtsfolgen:
Würde man dies bejahen, muss man an die Rechtsfolgen denken: Der Betreiber, respektive sein VfV, würde eine Prüffunktion einnehmen müssen, die nicht einmal die Behörden haben. Durch die Hintertür des Sonderbaurechts würde man dem Betreiber (und seinem VfV) die (Mit-)Verantwortung für das Tun und Lassen des Veranstalters aufbürden. Wir denken daran: Also der Person, die eigentlich nur eine Location vermieten möchte.Ein Vergleich zur Autovermietung: Der Autovermieter ist für den sicheren Zustand des Fahrzeugs verantwortlich: Die Bremsen und das Licht müssen funktionieren. Wenn aber der Mieter meint, mit dem Auto zu schnell zu fahren oder es falsch beladen zu müssen, kann das nicht dem Vermieter angelastet werden. Ja, der Vergleich hinkt etwas, aber auch nur etwas.
Das Sonderbaurecht ist, neben einzelnen Unfallverhütungsvorschriften oder DIN-Normen, auch das einzige Regelwerk, das sich mit der Sicherheit von Aufbauten in einer Versammlungsstätte beschäftigt. Immerhin, die MVStättVO ist damit das einzige Regelwerk, das der Gesetzgeber erlassen hat. Zu Lasten des Veranstalters gibt es solch ein Regelwerk aber nicht. Man könnte nun daraus schließen, dass der Gesetzgeber diese Verantwortung eben nicht dem Veranstalter in die Schuhe schieben will, sondern dem Betreiber. Aber: Aus welchem Grund? Es gibt ja keine „Not“, aus der heraus der Betreiber für Tun und Lassen seines Vertragspartners „Veranstalter“ mitverantwortlich gemacht werden müsste. Schließlich gibt es ja den Veranstalter, der aus zweierlei Gründen für die Sicherheit „seiner“ Veranstaltung(-stechnik) verantwortlich ist: Einmal aus seinem Vertrag mit dem Besucher, und einmal aus der sog. unerlaubten Handlung (§ 823 BGB). Es gibt also keinen gesetzgeberisch notwendigen Grund, daneben noch den Betreiber in die Verantwortung zu nehmen, der kraft seines Berufs „nur“ vermieten möchte. M.E. wäre das ein (zu) erheblicher Eingriff in die Berufsfreiheit des Betreibers durch die Hintertür des Sonderbaurechts.
3.) Betreiberhaftung für die Auswahl und Aufbau der Technik?
Der Betreiber hat oftmals keinen natürlichen Zugang zur Auswahl der veranstalterseitigen Technik; er müsste sich früh innerhalb des Planungsprozesses in die technischen Planungen des Veranstalters einbringen – bzw. diese sogar „führen“, wenn er augenscheinlich die Verantwortung via §§ 38, 40 MVStättVO zu übernehmen hätte. Ich erinnere: Er möchte „nur“ seine Location vermieten. Der Betreiber müsste beim Aufbau und im Laufe der Veranstaltung ständig diese Führungsaufgabe aufrecht erhalten – obwohl er nur vermieten wollte. Auch der Autovermieter ist nicht mehr für das Verhalten des Mieters verantwortlich, wenn der mit dem Mietwagen vom Gelände fährt. Und: Naturgemäß gibt es selten Einigkeit über „richtig“ und „falsch“, über „sicher“ und „unsicher“. Der Betreiber könnte in die unschöne Lage geraten, die fremde Veranstaltung abzubrechen oder umzubauen – in der Annahme, er sei für die fremde Technik und fremde Einbauten mit verantwortlich. Die für den Betreiber unkalkulierbare Folge: Der Veranstalter könnte im Nachgang Schadenersatzansprüche geltend machen. Der Betreiber würde also quasi ersatzweise für die Behörde zu einer Kontrollstelle erhoben, stünde aber voll im Risiko eines Regressanspruchs. Zum Vergleich: Wenn die Behörden einen Fehler machen, gibt es nur einen Anspruch gegen das Land/den Bund. Dieser Anspruch unterliegt aber – wenig verwunderlich – gewissen Beschränkungen. Der Regressanspruch des Betreibers, würde er aus Übervorsicht beim Veranstalter einen Schaden verursachen, ist aber gesetzlich nicht beschränkt. Warum aber soll ein Privater, der (würde man die Eingangsfrage bejahen) letztlich Kontrollaufgaben des Staates bzw. eines Dritten übernimmt, unbeschränkt haften, während der Staat sich auf sein Genehmigungsverfahren, die dortige Schlüssigkeitsprüfung und sein Haftungsprivileg zurückzieht? Natürlich kann der Gesetzgeber einer Person X gewisse Verantwortungen zuweisen. Aber: Würde die Ausgangsfrage bejaht, müsste sich wie dargestellt der Betreiber erheblich in die Veranstaltungsplanung seines Mieters einmischen und sähe sich erheblichen Regressforderungen ausgesetzt.
mehr erfahren
4.) Der Arbeitsschutz
Dies gilt umso mehr, wenn der Betreiber einen Mitarbeiter als VfV bestellen muss – und dieser Mitarbeiter ja dann auch strafrechtlich in die Mitverantwortung für Tun und Lassen des Veranstalters mit hineingezogen würde. Den Betreiber treffen bekanntlich auch Pflichten aus dem Arbeitsschutz zu Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter. Würde man die Ausgangsfrage aber bejahen, würde der VfV ein Risiko tragen, das auch nicht mit dem in § 39 MVStättVO geforderten Meister-Titel gerechtfertigt werden kann. Denn warum sollte einem sozialversicherungspflichtig abhängig beschäftigten VfV das Vort-Ort-Risiko des Vertragspartners seines Arbeitgebers aufgebürdet werden?