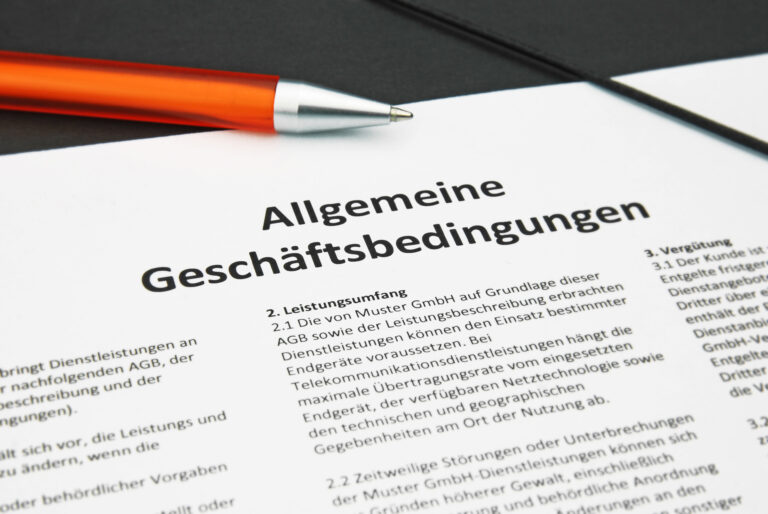Wer Veranstaltungen organisiert, hat natürlich ein Interesse daran, dass sein Haftungsrisiko so klein wie möglich ist. Das gilt umso mehr, wenn die Veranstaltung sportliche Elemente enthält oder aufgrund ihrer Art das Risiko größer ist, als bei einer gemütlichen Kaffeekranzrunde.
In unserer Beratungspraxis und in Webinaren kommt dann öfter die Frage, ob man sich vom Teilnehmer nicht am besten bestätigen lassen sollte: „Ich nehme auf eigenes Risiko teil“.
Wie sinnvoll sind derlei Klauseln bzw. Bestätigungen tatsächlich?
Ganz grundsätzlich gilt: Der Veranstalter muss seine Veranstaltung so organisieren, dass der durchschnittlich aufmerksame Teilnehmer unverletzt bleiben kann, wenn er sich durchschnittlich ordentlich verhält. Das bedeutet umgekehrt, dass der Veranstalter nicht alle denkbaren Sicherheitsmaßnahmen treffen muss, um seinen Teilnehmer zu schützen – sondern „nur“ diejenigen, die den durchschnittlichen Teilnehmer vor für ihn nicht erkennbare oder beherrschbare Gefahren schützt.
Zwei Beispiele:
- Gäste werden zu einem gemütlichen Schiffsausflug mit einem Ausflugsdampfer auf dem Bodensee eingeladen. Man muss nun die Gäste nicht darauf hinweisen, dass Lebensgefahr bestehen kann, wenn das Schiff sinkt oder wenn man über Bord fällt: Denn der durchschnittliche Gast kann sich das auch selbst denken.
- Es werden nur Kinder eingeladen zu einem Wanderausflug. Dazu soll auch gehören, dass die Kinder mit Messern eine Figur schnitzen sollen. Hier sollte der Veranstalter die Eltern darauf hinweisen, dass die Kinder mit echten Messern hantieren sollen; so können die Eltern, die die Fähigkeiten ihrer Kinder beurteilen können, entscheiden, ob ihr Kind dazu in der Lage ist.
In beiden Fällen wäre es also gar nicht nötig, dass der Teilnehmer (bzw. die Eltern) bestätigen, dass sie auf eigenes Risiko teilnehmen. Vielmehr notwendig ist aber, dass der Veranstalter eben auf nicht erkennbare bzw. nicht beherrschbare Risiken aufmerksam macht (und zwar so, dass er das später auch beweisen kann).