
Geschlossene Veranstaltung
Wann ist eine
Veranstaltung „geschlossen“,
was hat das für Rechtsfolgen?
Eine „geschlossene Veranstaltung“ bzw. „geschlossene Gesellschaft“ signalisiert, dass nicht geladene oder nicht akkreditierte Gäste auch nicht eingelassen werden sollen, z.B. bei Betriebsfeiern, Hochzeitsfeiern usw.
Wie der Veranstalter seine Veranstaltung nennt, ist aber zweitrangig, wenn es um die rechtliche Einordnung der Veranstaltung geht.
So kann eine „geschlossene Veranstaltung“ trotzdem eine im Rechtssinne öffentliche Veranstaltung sein, so dass bei Musiknutzung auch GEMA zu zahlen wäre.
- D.h. nur weil eine Veranstaltung als „geschlossen“ deklariert wird, ist sie nicht automatisch privat.
- Ebenso, nur weil nur geladene Gäste eingelassen werden, muss die Veranstaltung auch nicht zwangsläufig „privat“ sein.
Das ist bspw. dann der Fall, wenn die Teilnehmer der Veranstaltung nicht innerlich verbunden sind – entweder untereinander oder zum Veranstalter. Fehlt es an der inneren Verbundenheit, dann ist zwar die Veranstaltung für weitere Teilnehmer „geschlossen“, sie ist aber dennoch öffentlich im rechtlichen Sinne.
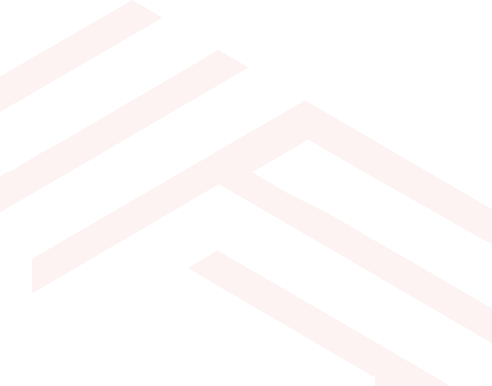

Interessiert an Webinaren?
In unserer Terminübersicht entdecken Sie aktuelle Themen aus dem Veranstaltungsrecht, die wir demnächst erklären – verständlich, ohne „Juristen-Deutsch“ und kostenfrei.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die (bisher engen) Grenzen der Privatheit etwas erweitert: Fehlt zwar eine innere Verbundenheit, sind aber zumindest „nicht viele Personen“ anwesend – dann würde man im urheberrechtlichen Sinn (bzgl. GEMA bei Musiknutzung, oder dem Einsatz bspw. von Fotos in einer Präsentation) von einer privaten Nutzung ausgehen können.
Leider hat der EuGH nicht gesagt, wie viele die „nicht vielen Personen“ sein dürfen. Man wäre auf der sicheren Seite, wenn man sich an den bisherigen Kriterien orientiert. Nur bei Kleinstveranstaltungen mit vielleicht 2-5 Teilnehmern könnte man mal genauer hinterfragen, ob ggf. die neue Rechtsprechung des EuGH greifen könnte. Gerne stehen wir Ihnen hier beratend zur Seite.
Vereinsfeste = geschlossene Veranstaltung?
Gerade bei Vereinen stellt sich die Frage, ob ein Vereinsfest, bei dem nur Mitglieder eingeladen werden, öffentlich oder privat ist.
Dazu muss man fragen: Ist der Verein auf Mitgliederzuwachs ausgelegt? Denn dann wird es schwierig, die innere Verbundenheit zu begründen. Ein kleiner Skatclub, bei dem sich die Mitglieder seit Jahren unverändert regelmäßig zum Spielen treffen, wird sich auch in einer privaten Veranstaltung treffen können. Ein Sportverein (z.B. ein Fußballverein) wird es da schwerer haben, die innere Verbundenheit beweisen zu können:
Einerseits ist ein Fußballverein üblicherweise auf Wachstum ausgelegt, d.h. es sollen neue Mitglieder hinzukommen, d.h. diese neuen Mitglieder ebenso wie ausgeschiedene Mitglieder führen dazu, dass eine innere Verbundenheit schon fraglich ist.
Andererseits spricht auch eine höhere Mitgliederzahl gegen die innere Verbundenheit – je mehr Mitglieder es gibt, desto schwieriger wäre sie nämlich auch nachzuweisen.
Sicherheit
Übrigens: Die „Geschlossenheit“, auch die „Privatheit“ einer Veranstaltung führt nicht dazu, dass Sicherheitsanforderungen bzw. Anforderungen an die Verkehrssicherung sinken würden. Auch der Veranstalter einer Geburtstagsfeier ist verkehrssicherungspflichtig und für die Sicherheit seiner Gäste verantwortlich (jedenfalls soweit dies notwendig und zumutbar ist).
Rechtsfolgen der Geschlossenheit
Da es im juristischen Sinne die „geschlossene Veranstaltung“ nicht gibt, erwachsen aus ihr auch keine gesetzlichen Rechtsfolgen – allenfalls durch sein Hausrecht kann der Veranstalter der geschlossenen Veranstalter Regeln festlegen.
Gesetzliche Rechtsfolgen gibt es, wenn die geschlossene Veranstaltung zugleich auch „privat“ ist:
- Bei Musiknutzung muss keine GEMA-Gebühr bezahlt werden.
- Allgemein greifen die Anforderungen aus dem Urheberrecht in den meisten Fällen nicht – solange bspw. Fotos aber auch im ausschließlichen privaten Bereich genutzt werden.
- Werden selbständige Künstler (z.B. ein DJ) oder Publizisten beauftragt, müssen keine Abgaben zur Künstlersozialkasse bezahlt werden.
- Die Anwendung der DSGVO entfällt, solange die Datenverarbeitungen „durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten“ (siehe Art. 2 Abs. 2c DSGVO) erfolgen. Beispiel: Man speichert sich von seinem Bekannten die Handynummer oder macht ein Foto.
- Ggf. ist keine behördliche Genehmigung erforderlich – u.a. solange die private Veranstaltung nicht gewerblich oder kommerziell veranstaltet wird, und die Öffentlichkeit bspw. durch Lärm nicht beeinträchtigt wird.
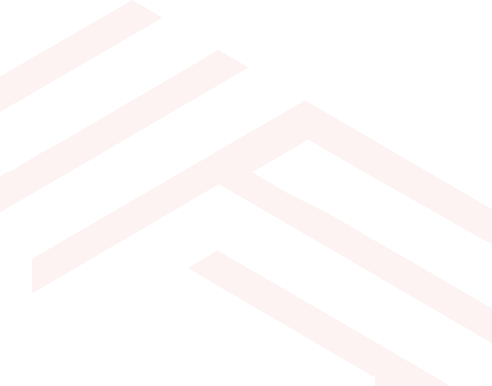

Interessiert an Webinaren?
In unserer Terminübersicht entdecken Sie aktuelle Themen aus dem Veranstaltungsrecht, die wir demnächst erklären – verständlich, ohne „Juristen-Deutsch“ und kostenfrei.
Weiterführende Links:
Lexikon Veranstaltungsarten Firmenfeier Akkreditierung/Einlass
