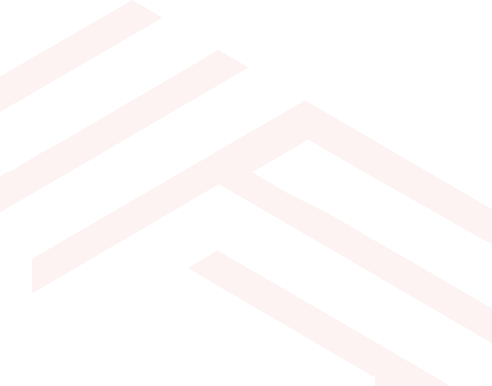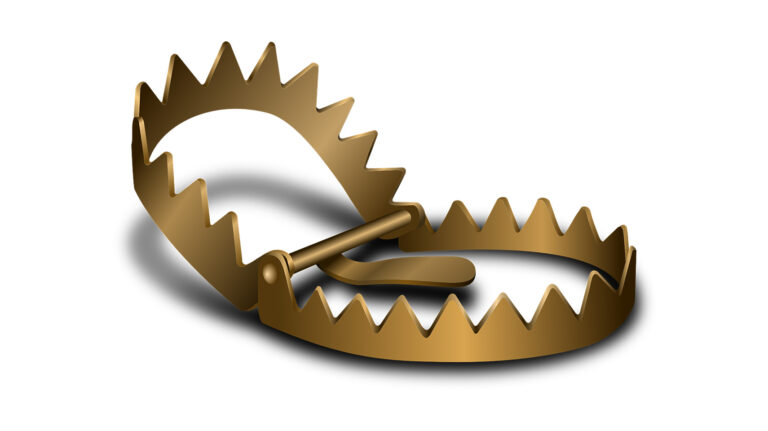Der Idealfall eines Vertrages ist, dass beide Vertragspartner ihre vollständigen Leistungen erbringen. Was aber passiert, wenn der Vertrag vorzeitig beendet wird – bspw. durch Höhere Gewalt, Kündigung oder Rücktritt?
Hier die eindeutige Antwort des Juristen: Es kommt darauf an.
Worauf kommt es an?
Zunächst schaut man in den Vertrag: Wurde dort etwas für diesen Fall vereinbart?
Nur, weil etwas im Vertrag geregelt ist, ist diese Regelung nicht automatisch wirksam. Bevor man also zahlt bzw. auf Geld verzichtet, sollte geprüft werden, ob die Klausel wirksam ist (das wäre sie dann nicht, wenn sie eklatant gegen das gesetzliche Leitbild verstößt – das kann bspw. daran erkennbar sein, dass die vertragliche Lösung sehr einseitig formuliert ist).
Wir prüfen Ihre AGB und Verträge, ebenso unterstützen wir Sie bei der Formulierung! Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@eventfaq.de oder buchen Sie online direkt einen Termin.
Warum wurde der Vertrag vorzeitig beendet?
Die erste Frage ist, warum der Vertrag nicht sein geplantes Ende gefunden hat. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die – wenig überraschend – auch zu unterschiedlichen Rechtsfolgen führen können:
- Anfechtung wg. Irrtums: Es gibt gesetzlich anerkannte Fälle des Irrtums, die zum Vertragsschluss geführt haben. Sie berechtigen Irrenden, den Vertrag rückwirkend durch Anfechtung der eigenen Willenserklärung (entweder das Angebot oder die Annahme) aufzuheben. Aber: Wer sich irrt, ist ggf. dem anderen zum Schadenersatz verpflichtet.
- Anfechtung wg. Täuschung: Kam der Vertrag aufgrund einer Täuschung oder Drohung zustande, kann man später auch seine Willenserklärung anfechten. Anders als beim Irrtum, kann sich aber jetzt der Täuschende oder Drohende schadenersatzpflichtig machen.
- Nichtigkeit: Der Vertrag kann auch nichtig sein, bspw. weil er sittenwidrig ist oder gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Dann werden die Vertragspartner so gestellt, als ob es den Vertrag nie gegeben hätte. Beispiele sind hier Verträge über Schwarzarbeit oder Fernunterrichtslehrgänge ohne Zulassung.
- Rücktritt: Ein Rücktritt vom Vertrag ist möglich, wenn der andere Vertragspartner (ggf. trotz Mahnung) die geschuldete Leistung nicht erbringt. Berühmte Beispiele dafür sind Verzug und Höhere Gewalt. In diesem Fall wird der Vertrag „rückabgewickelt“, d.h. die Vertragspartner werden so gestellt, als ob sie sich nie gesehen hätten. Wer aber bspw. den Verzug zu vertreten hat, kann sich schadenersatzpflichtig machen. Bei höherer Gewalt macht sich kein Vertragspartner schadenersatzpflichtig.
- Kündigung: Kündigungen sind rechtlich betrachtet in die Zukunft gerichtet, d.h. im Regelfall muss die erbrachte Leistung bezahlt werden. Es gibt ordentliche Kündigungen und außerordentliche Kündigungen („fristlos“); im Vertrag kann (nur) die ordentliche Kündigung ausgeschlossen werden.
- Stornierung: Nur dann, wenn im Vertrag eine Stornierung erlaubt ist, kann ein Vertragspartner auch stornieren. Fehlt eine Stornoklausel, kann auch nicht storniert werden. Die Stornierung ist gesetzlich nicht geregelt, d.h. es kommt dann auf die Bedingungen der Stornoklausel an – aber auch hier gilt: Diese Bedingungen müssen wirksam formuliert sein!
- Einvernehmliche Aufhebung: Schließlich können die Vertragspartner sich auch auf ein vorzeitiges Ende einigen; in diesem Fall macht es Sinn, nicht nur das Ende festzustellen, sondern auch die Frage der gegenseitigen Leistungen.
Wurde die Rechtsfolge im Vertrag (wirksam) geregelt?
Nicht immer ist die gesetzlich vorgesehene Rechtsfolge „gut“, daher kann es sinnvoll sein, im Vertrag abweichende Regelungen zu treffen. Ein bekanntes Beispiel ist auch hier wieder die höhere Gewalt:
Nehmen wir an, eine Eventagentur wird mit der Planung einer Veranstaltung beauftragt, und die Agentur investiert auftragsgemäß viele Tage Arbeit. Unerwartet platzt der Vertrag aufgrund Höherer Gewalt (juristisch heißt das, dass eine der Leistungen objektiv und ohne Verschulden der Vertragspartner unmöglich geworden sein muss).
Gesetzliche Rechtsfolge für die Agentur unangenehm
Das Gesetz sieht nun vor, dass bei Höherer Gewalt kein Vertragspartner ein Risiko tragen soll, d.h. alle gegenseitigen Leistungen werden gegeneinander aufgehoben. Das heißt aber auch, dass etwaige vom Veranstalter an die Agentur bezahlten Vorschüsse wieder erstattet werden müssen, und die Agentur letztlich umsonst hat arbeiten müssen.
Seltene Ausnahme: Die Agentur kann den Teil der vereinbarten Vergütung verlangen, der auf den für den Veranstalter verwertbaren Teil entfällt. Ist bspw. das Konzept fertiggestellt und ist es dem Veranstalter zumutbar, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, müsste er zumindest die Arbeit für das Konzept bezahlen.
Abweichung im Vertrag möglich
Wenn die Agentur diese Risiken nicht eingehen möchte, kann sich im Vertrag bspw. vereinbaren, dass sie in jedem Fall für die geleistete Arbeit vergütet wird.
 Wichtig dabei: Die Agentur darf es in der Klausel nicht übertreiben und bspw. nicht formulieren, dass der Kunde bei Höherer Gewalt „alles“ bezahlen müsse unabhängig vom Bearbeitungsstand – denn diese Regelung würde wiederum komplett das gesetzliche Leitbild (= Agentur geht leer aus, s.o.) ins Gegenteil verkehren, und derlei Klauseln sind bei mehrfacher Verwendung („AGB„) unwirksam.
Wichtig dabei: Die Agentur darf es in der Klausel nicht übertreiben und bspw. nicht formulieren, dass der Kunde bei Höherer Gewalt „alles“ bezahlen müsse unabhängig vom Bearbeitungsstand – denn diese Regelung würde wiederum komplett das gesetzliche Leitbild (= Agentur geht leer aus, s.o.) ins Gegenteil verkehren, und derlei Klauseln sind bei mehrfacher Verwendung („AGB„) unwirksam.
Ausnahme auch hier: In einer sog. Individualvereinbarung wäre eine solche extreme Regelung durchaus wirksam.
Gegenausnahme: Ist der zahlungspflichtige Vertragspartner eine Privatperson, darf grundsätzlich gar nicht oder in sehr engen Schranken vom gesetzlichen Leitbild (= „Agentur geht leer aus“) abgewichen werden.
Man sieht: Es kommt auf einige Details an, ob der Dienstleister oder Vermieter von seinem Vertragspartner Geld verlangen kann, wenn der Vertrag vorzeitig beendet wird – manche davon können im Vertrag vom Gesetz abweichend vereinbart werden.