
Catering
bei Veranstaltungen
Hygiene, Allergieabfrage,
Sicherheit, Crew-Catering
und die rechtlichen Besonderheiten
Werden Gäste, Mitwirkende und/oder Beschäftigte mittels Catering versorgt, gibt es auch hier einige rechtliche Besonderheiten.
Zunächst:
Was ist der Unterschied zwischen Caterer und Gastwirt?
Der Hauptunterschied zwischen Gaststättenbetrieb im Reisegewerbe und einem Cateringunternehmen liegt in der Art und Weise, wie der Kunde erreicht wird und wo die Speisen zubereitet und verzehrt werden.
Einen auffälligen Unterschied erkennt man beim Kunden:
Wenn der Gastwirt die Initiative ergreift und wartet, dass Kunden zu ihm kommen und seine Speisen bzw. Getränke kaufen, dann liegt eine Gaststätte vor – ggf. im Reisegewerbe (z.B. Foodtruck auf einer Veranstaltung).
Der Gastwirt benötigt eine Konzession bzw. auch eine Reisegewerbekarte, sofern er keine reisegewerbekartenfreie Tätigkeit ausübt, z.B. gelegentlich der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen, öffentlichen Festen oder aus besonderem Anlass mit Erlaubnis der zuständigen Behörde Waren feilbietet.
Gastwirt kann der Veranstalter sein, aber auch bspw. der Vermieter der Location.
Wenn der Veranstalter den Caterer beauftragt, die Gäste seiner Veranstaltung zu verpflegen, dann geht die Initiative vom zahlenden Kunden = vom Veranstalter aus.
In diesem Fall ist der Caterer kein Gastwirt i.S.d. Gaststättenrechts. Der Unterschied macht sich dann in der Verwaltung bemerkbar: Der Caterer braucht keine Schanklizenz und keine Reisegewerbekarte, sondern muss lediglich sein Cateringgewerbe anmelden. D.h. die Behörde kann dem Caterer grundsätzlich sein Gewerbe nicht verbieten, dem Gastwirt hingegen schon, wenn es ihm bspw. an Zuverlässigkeit fehlt.
Unter Umständen kann der Veranstalter Gastwirt i.S.d. Gaststättenrechts sein, wenn er in seiner Person die Voraussetzungen erfüllt; dann benötigt er ggf. auch eine Konzession bzw. Reisegewerbekarte.
Schauen wir uns nun einzelne rechtliche Aspekte für das Catering an:
1. Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Diese Themen sind geprägt von einer Vielzahl von Regelwerken, die wir hier nicht detailliert abbilden bzw. wiedergeben können. Aber hier finden Sie gute Informationen:
Das Dokument „Feste sicher feiern“ ist eine Leitlinie zur Hygiene für Veranstalter, erarbeitet unter der Leitung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft.
Sie richtet sich grundsätzlich an Veranstalter von gelegentlich stattfindenden, öffentlich zugänglichen Festveranstaltungen, zum Beispiel Vereins-, Sport-, Straßen- oder Dorffeste oder an ähnlichen Veranstaltungsorten, für die typisch ist, dass insbesondere Privatpersonen die Herstellung von Speisen und Getränken sowie deren Ausgabe übernehmen. Solche Veranstalter sind in der Regel keine Lebensmittelunternehmer und damit nicht zur umfänglichen Einhaltung der EU-Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) verpflichtet.
Für Lebensmittelunternehmer, z.B. auch professionelle Caterer, ist diese Leitlinie als ergänzende Information zu bereits bestehenden und anerkannten Branchen-Leitlinien zu verstehen.
Dies gilt auch bspw. für den „Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln auf Vereins- und Straßenfesten“ des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.
2. HACCP
HACCP steht im Englischen für „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (auf deutsch: Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte). HACCP bildet einen systematischen Ansatz, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Die wesentlichen Prinzipien und Methoden des HACCP-Systems sind in diversen Lebensmittelvorschriften der EU verankert.
Daneben gibt es in Deutschland die Gastwirteunterrichtung, die Voraussetzung zur Erlangung einer Gaststättenkonzession ist (siehe § 4 Absatz 1 Nr. 4 GastG), und die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz durch das Gesundheitsamt (§ 43 Infektionsschutzgesetz).
3. Hinweispflichten
Die EU-Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) gewährleistet, dass Allergiker bereits vor ihrer Kaufentscheidung ohne zusätzliche Nachfrage darüber informiert werden, welche der 14 deklarationspflichtigen Allergene in einer Speise enthalten sind. Damit soll ein umfassender Schutz vor einer allergischen Reaktion gewährleistet werden.
Die Allergenkennzeichnungen müssen bei der Veranstaltung deutlich sichtbar, leicht zugänglich und ohne Aufforderung den Gästen zugänglich sein.
4. Abfrage der Allergien?
Darf der Veranstalter bei seinen Gästen nach Allergien fragen, um vorab auch den Caterer zu informieren? Es sind dann einige datenschutzrechtliche Besonderheiten zu beachten.
Allergien sind sog. „personenbezogene Daten besonderer Kategorie“ (siehe Art. 9 DSGVO). Werden also solche Daten erhoben, greift mit Art. 9 DSGVO eine besondere Schutzvorschrift: Ihre Verarbeitung ist grundsätzlich verboten!
In Art. 9 Absatz 2 DSGVO finden sich einige Ausnahmen; die promineste Ausnahme ist, dass die Verarbeitung zulässig ist, wenn der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat. Das heißt: Soll ein Teilnehmer bspw. angeben, ob er eine Allergie hat, dann darf diese Information nur abgefragt werden, wenn der Teilnehmer ausdrücklich einwilligt.
Vorsicht: Ist die Einwilligung fehlerhaft, dann ist auch die Verarbeitung rechtswidrig. Dementsprechend hoch ist das Risiko für den Veranstalter bzw. die beauftragte Agentur, wenn sie solche Informationen abfragen.
 Man kann auch nicht etwa argumentieren, dass die Abfrage ja zum Schutz des Teilnehmers sei: Dieses Argument findet sich nicht im Katalog der Ausnahmen vom Verarbeitungsverbot (Art. 9 Abs. 2 DSGVO). Außerdem: Das Risiko für den Teilnehmer der Veranstaltung ist ja gar nicht höher als sonst: Denn auch dann, wenn er selbst ein Restaurant besucht, hat er die Allergie und muss sich selbst darum kümmern, was er isst.
Man kann auch nicht etwa argumentieren, dass die Abfrage ja zum Schutz des Teilnehmers sei: Dieses Argument findet sich nicht im Katalog der Ausnahmen vom Verarbeitungsverbot (Art. 9 Abs. 2 DSGVO). Außerdem: Das Risiko für den Teilnehmer der Veranstaltung ist ja gar nicht höher als sonst: Denn auch dann, wenn er selbst ein Restaurant besucht, hat er die Allergie und muss sich selbst darum kümmern, was er isst.
Abgesehen von den datenschutzrechtlichen Risiken einer fehlerhaften Einwilligung und Datenschutzinformation besteht noch ein anderes Risiko: Nämlich dann, wenn der Veranstalter bzw. die Agentur die Informationen versehentlich falsch weitergeben. Denn der Teilnehmer darf, wenn schon solche Informationen abgefragt werden, ggf. darauf vertrauen, dass das Catering auf seine Informationen ausgerichtet ist.
5a. Catering für Mitwirkende
Ggf. ist der Veranstalter vertraglich verpflichtet, Künstlern oder Technikern usw. ein Catering zur Verfügung zu stellen. Wenn man das Thema schon vertraglich regelt, sollte nicht nur geklärt werden, wer sich um das Catering kümmert, sondern vorsorglich auch, wer es bezahlt.
Ist nichts konkret geregelt oder vorgegeben (bspw. durch einen Catering Rider), ist ein Catering mittlerer Art und Güte zur Verfügung zu stellen – gemessen u.a. am Erwartungshorizont, der Üblichkeit, ggf. bereits in der Vergangenheit geübter Praxis.
5b. Catering für Dienstleister
Das Vorstehende gilt auch für Mitarbeiter der Dienstleister. Hier ist ggf. aber noch zu beachten, dass vorsorglich zu vermeiden ist, dass bspw. alle Sicherheitsdienstmitarbeiter das gleiche Essen bekommen: Es wäre nicht das erste Mal, dass die gesamte Mannschaft ausfällt, weil sie sich eine Legionellen-Infektion o.ä. eingefangen hätten…!
5c. Catering für Mitarbeiter
Generell ist ein Arbeitgeber nicht verpflichtet, seinem Mitarbeiter Essen oder Getränke anzubieten.
Das kann aber anders sein, wenn es dem Mitarbeiter aufgrund der Lage der Veranstaltungsstätte und Dauer der Veranstaltung nicht zuzumuten ist, für eine eigene Verpflegung angemessen sorgen zu können. Bei Hitze wird ein Arbeitgeber aus Gründen des Arbeitsschutzes prüfen müssen, ob er zumindest Trinkwasser zur Verfügung stellen sollte oder muss:
- Auf Baustellen in der Nähe der Arbeitsplätze (siehe Nr. 5.2 des Anhangs zur Arbeitsstättenverordnung).
- Bei Lufttemperaturen von mehr als +26 °C sollen, bei mehr als +30 °C müssen geeignete Getränke bereitgestellt werden (siehe Ziffer 4.4. Absatz 5 der ASR 3.5).
6. Sicherheitsmaßnahmen durch Behörde?
Das Gaststättenrecht sieht vor, dass die für die Erlaubnis und Gestattung zuständige Behörde jederzeit Auflagen zum Schutze
- der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit,
- der im Betrieb Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder
- gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und sonst gegen erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit
erteilen kann (siehe § 5 GastG).
Diese Rechtsnorm berechtigt aber die Behörde nicht, vom Veranstalter Sicherheitsmaßnahmen bzw. ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung zu verlangen, wenn der Veranstalter nicht zugleich Gastwirt ist.
7. Gaststättenrecht
Erfüllt der Caterer die Voraussetzungen an einen Gaststättenbetrieb, gelten für ihn die gaststättenrechtlichen Bestimmungen. Dafür ist sachlich die Gaststättenbehörde (oftmals angesiedelt im Ordnungsamt) zuständig. Sie darf bspw. auch Auflagen zur Sicherheit erlassen – Adressat dieser Auflagen kann aber nur der Gastwirt sein.
8. Reisegewerbekarte
Unter Umständen braucht der Caterer eine sog. Reisegewerbekarte (siehe § 55 GewO). Berühmtes Beispiel ist der Foodtruck. Ist die Veranstaltung gewerberechtlich festgesetzt, können Reisegewerbetreibende von der Pflicht zur Reisegewerbekarte befreit sein.
9. Verkehrssicherung
Schauen wir noch auf die Verkehrssicherungspflichten, wenn bspw. Stromkabel oder Wasserleitungen verlegt werden: Die Rechtsprechung nimmt hier auf den (stolpernden) Besucher in die Pflicht; wer als Besucher eine Veranstaltung besucht, die bspw. auf einem Marktplatz im Freien stattfindet, muss damit rechnen, dass Kabel und Leitungen oberirdisch verlegt werden müssen – solange die Leitungen „so gut wie möglich“ gegen Stolpern gesichert sich, bspw. so niedrig wie möglich, ggf. mit Rampen gesichert, farblich markiert, beleuchtet usw.
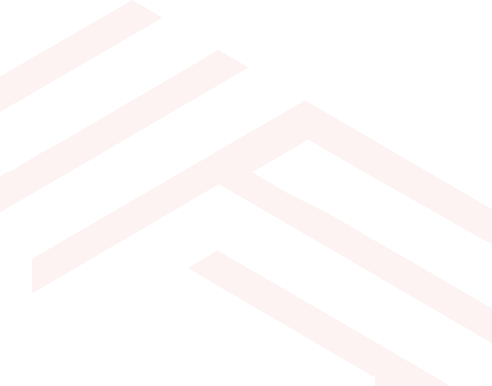

Neue AGB oder Verträge?
Sie wollen sich absichern? Sie brauchen einen möglichst „wasserdichten“ Vertrag bzw. AGB? Sie haben ein spezielles Projekt und brauchen dazu spezielle Regelungen?
Weiterführende Links: