
Betriebsveranstaltung
und ihre rechtlichen
Besonderheiten
Betriebliche Veranstaltungen sind eine besondere Veranstaltungsart. Sie bergen einige Besonderheiten in sich: So kann eine Weihnachtsfeier eine Betriebsveranstaltung sein, die unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung fällt – die Arbeitnehmer wären dann gesetzlich unfallversichert, wenn auf der Feier oder auf dem Hin- oder Heimweg etwas passiert. Oder es ist nur eine betriebliche Veranstaltung, die eben nicht unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung fällt.
Bei betrieblichen Veranstaltungen muss man auch immer in Frage stellen, ob sie „privat“ oder „öffentlich ist; nur, weil ein Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsvertrages zur Feier kommt, ist die Feier deshalb nicht automatisch „privat“. Die Folgen sind erheblich, weshalb man genau hinschauen muss.
Schließlich bringen betriebliche Veranstaltungen auch immer steuerrechtliche Fragen mit sich: Ist die Feier beim Arbeitnehmer zugleich Lohn, der zu versteuern ist?
Grundsätzlich funktioniert eine Betriebsveranstaltung wie jede andere Veranstaltung auch. Hier haben wir in den FAQ ein paar Besonderheiten dargestellt.
Unterschied zur Firmenfeier bzw. zu Firmenevents
Die Veranstaltungen kann man natürlich bezeichnen, wie man will; aber klassischerweise meint die Betriebsveranstaltung eine solche Veranstaltung, die sich hauptsächlich an die eigenen Mitarbeiter richtet, während die Firmenfeier bzw. das Firmenevent darüber hinaus sich auch an Kunden, Lieferanten usw. richtet.
Jedenfalls hier in der Übersicht der Veranstaltungsarten trennen wir beide Veranstaltungen wie beschrieben.
Muss der Geschäftsführer anwesend sein?
Die Sozialgerichte hatten bisher für die Annahme eines Arbeitsunfalls auf einer Betriebsveranstaltung u.a. darauf abgestellt, dass die Geschäftsleitung anwesend sein muss. Diese Voraussetzung hat das Bundessozialgericht nunmehr ausdrücklich aufgehoben:
Chef muss nicht mehr anwesend sein
„Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen stünden unter dem Schutz der Gesetzlichen Unfallversicherung, weil durch sie das Betriebsklima gefördert und der Zusammenhalt der Beschäftigten untereinander gestärkt werde. Dieser Zweck werde auch erreicht und gefördert, wenn kleinere Untergliederungen eines Betriebes Gemeinschaftsveranstaltungen durchführten. Die Teilnahme der Betriebsleitung oder des Unternehmers persönlich sei hierfür nicht erforderlich. Ausreichend sei daher, wenn durch eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung die Verbundenheit und das Gemeinschaftsgefühl der Beschäftigten in dem jeweiligen Sachgebiet oder Team gefördert werde, so das Bundessozialgericht in seiner heutigen Entscheidung.
Notwendig ist dafür lediglich, dass die Feier allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des jeweiligen Teams offen gestanden habe und die jeweilige Sachgebiets- oder Teamleitung teilnehmen.
Das Bundessozialgericht hat damit eine Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts aufgehoben. Eine Abteilung der Deutschen Rentenversicherung hatte mit dem Wissen der Geschäftsleitung seit Jahren eine Weihnachtsfeier veranstaltet, aber eben nur eine kleine Abteilung. Auf einem Fest hatte sich eine Mitarbeiterin verletzt, das Landessozialgericht hatte aufgrund des Fehlens der Geschäftsleitung einen Arbeitsunfall abgelehnt: es habe sich nicht um eine Gemeinschaftsveranstaltung gehandelt.
Diese Rechtslage hatte dazu geführt, dass Abteilungsfeiern nicht unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung fielen. Dies ist nun vorerst mit dem aktuellen Urteil des Bundessozialgerichts vorbei.
Öffentliche oder private Betriebsfeier?
Private oder öffentliche Veranstaltung? Mitarbeiter-Incentives, Betriebsveranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstage, Trauerfeiern, Jubiläen… Ob eine Veranstaltung öffentlich oder privat ist, ist an zwei Merkmalen festzumachen: Ist der Personenkreis der Teilnehmer abgrenzt? Sind die Teilnehmer zueinander oder zum Veranstalter innerlich verbunden?
Abgrenzbarkeit
Ein Personenkreis ist dann nicht abgegrenzt, wenn Jedermann teilnehmen kann.
Beispiel 1: Das Stadtfest, das Jedermann ohne jegliche Zugangskontrolle besuchen kann.
Beispiel 2: Das Konzert, das Jedermann nach Kauf einer Eintrittskarte besuchen kann.
Beispiel 3: Das Seminar, bei dem Jedermann nach Anmeldung und Zahlung der Seminargebühren teilnehmen kann.
Ein Personenkreis ist also nicht deshalb „abgegrenzt“, weil nicht Jedermann eingelassen wird – denn wenn im Vorfeld Jedermann hätte Einlass verlangen bzw. sich hätte erkaufen können (durch eine Eintrittskarte), dann ist der Personenkreis auch nicht abgrenzt. Im Übrigen würde es dann oft schon an der Verbundenheit (siehe sogleich Ziffer 2.) scheitern: Denn wenn Jedermann mitmachen darf, dann kennen sich die Teilnehmer/Besucher auch nicht, so dass zwischen ihnen auch die erforderliche Verbundenheit fehlt.
Innere Verbundenheit
Maßgeblich ist nicht, ob sich die Teilnehmer nur kennen bzw. sich sympathisch sind. Maßgeblich ist auch nicht, dass eine familiäre oder freundschaftliche Beziehung besteht.
Relevant ist aber, ob ein enger gegenseitiger Kontakt und eine gemeinsame private Sphäre besteht.
Dafür ist nicht ausreichend, dass dieser Kontakt durch einen Vertrag hergestellt wird: Nur, weil im Betrieb ein Mitarbeiter arbeitet, ist dieser noch nicht zum Betriebsinhaber bzw. zu anderen Mitarbeitern innerlich verbunden.
Auch nicht ausreichend ist, dass alle Teilnehmer ein und derselben Gruppe angehören (z.B. Vereinsmitglieder). Gerade wenn – wie in einem Verein – die Mitglieder der Gruppe regelmäßig wechseln bzw. die Gruppe darauf angelegt ist, dass regelmäßig neue Mitglieder dazu kommen, fehlt es typischerweise an einer Verbundenheit.
Je mehr Teilnehmer anwesend sind, desto eher spricht das gegen eine solche Verbundenheit. Ab ca. 100 Teilnehmern wird es daher erfahrungsgemäß schwierig werden, eine innere Verbundenheit nachweisen zu können (das ist nicht unmöglich, wie man am Beispiel einer als privat eingestuften Hochzeit mit über 600 Gästen sieht, aber eben schwierig).
Werden zum Kreis eigentlich innerlich verbundener Personen Außenstehende eingeladen, wird es schwierig.
Beispiel: In einem kleinen Betrieb mit 5 Mitarbeitern, die seit 10 Jahren eng befreundet sind und auch privat viel gemeinsam unternehmen, wird gefeiert. Zu dieser Feier dürfen die Mitarbeiter Ihre Ehepartner mitbringen. Hier hatten Gerichte bereits entschieden, dass dann die Privatheit der Veranstaltung verloren geht. Maßgeblich dürfte aber wohl eher sein, dass die Veranstaltung trotz Außenstehender noch ihren typischen privaten Charakter behält, was allerdings dann immer auch eine Einzelfallentscheidung ist.
Kriterien des BGH
Der Bundesgerichtshof hat zur Orientierung einige klare Regeln aufgestellt:
- Die Betriebsveranstaltung ist nicht deshalb privat, weil die Teilnehmer alle aus einem Betrieb stammen.
- Die Anbringung von Schildern bspw. mit dem Hinweis „Geschlossene Gesellschaft” spielt keine Rolle.
- Die Lebenserfahrung spricht bei einem großen Kreis von Betriebsangehörigen dagegen, dass ein vertrauterer persönlicher Kontakt zwischen den einzelnen Belegschaftsmitgliedern besteht.
- Das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das in der Regel zwischen den einzelnen Betriebsangehörigen während ihrer Zugehörigkeit zum gleichen Betrieb gegeben sein wird, sagt nichts darüber aus, ob die Betriebszugehörigkeit über die gleichgerichteten Arbeitsinteressen und die Werkverbundenheit hinaus zu einem so engen persönlichen Zusammenschluss der einzelnen Betriebsangehörigen untereinander führt, dass die Voraussetzung für Privatheit erfüllt wäre.
- Unentgeltlichkeit ist kein Indiz für Nicht-Öffentlichkeit.
- Wenn Familienangehörige, Verlobte oder Freunde der Betriebsangehörigen teilnehmen spricht dies für Öffentlichkeit (da es dann an dem Merkmal abgrenzbarerer Personenkreis fehlt).
Privat oder öffentlich? Die Folgen
Ist eine Veranstaltung öffentlich, muss ggf. GEMA-Gebühr bezahlt werden, wenn fremde Musik genutzt wird. Außerdem greift das Gaststättengesetz, das Jugendschutzgesetz, ggf. sind Abgabe der Künstlersozialkasse zu entrichten usw.
Sonderfall KSK:
Bei der Künstlersozialversicherung gilt eine Betriebsveranstaltung auch dann als „privat“, wenn sich die Mitarbeiter untereinander nicht sonderlich innerlich verbunden fühlen – solange die Veranstaltung nur nach „innen“ wirkt und auch nur Mitarbeiter und enge Angehörige eingeladen werden. Sobald aber Freie Mitarbeiter oder Kunden dazu kommen, gilt diese Ausnahme nicht mehr.
Beachten Sie, dass es bei der GEMA diese Ausnahme der Künstlersozialkasse nicht gibt.
Betrunken auf der Betriebsfeier: Unfallversichert?
Ein Besäufnis im Anschluss einer Betriebsveranstaltung führt nicht automatisch dazu, dass der gesetzliche Unfallversicherungsschutz entfällt. So hatte ein Betriebsrat eines größeren Konzerns an einer Betriebsratstagung teilgenommen; an deren Ende um 19 Uhr gab es ein geselliges Zusammensein. Der Betriebsrat stürzte gegen 1 Uhr auf dem Weg auf sein Hotelzimmer mit 1,99 Promille und verletzte sich schwer. Die Berufsgenossenschaft lehnte einen Arbeitsunfall ab.
Das Sozialgericht Heilbronn allerdings entschied, dass der Unfall ein Arbeitsunfall sei.
Der eigentliche Teil der Betriebsratstagung habe zwar bereits gegen 19 Uhr geendet, im Anschluss habe man aber sowohl Privates als auch Dienstliches besprochen, so das Gericht. Daher sei der Weg in das Hotelzimmer noch Arbeitsweg.
Das Gericht merkte noch an, dass ein Arbeitsweg selbst dann noch vorliegen würde, wenn es beim geselligen Teil nur private Gespräche gegeben hätte, da bei beruflich veranlassten Veranstaltungen eine Trennung zwischen dienstlichen und privaten Belangen kaum möglich sei; diesbezüglich gibt es aber durchaus auch gegenteilige Entscheidungen anderer Gerichte.
Der hohe Alkoholpegel ändere nichts am Arbeitsunfall. Für Fußgänger gebe es keine Promillegrenze; solange der Betriebsrat keine konkreten alkoholbedingten Ausfallerscheinungen zeige, was die Berufsgenossenschaft nachzuweisen habe, sei er noch immer unfallversichert.
Lohnsteuer der Mitarbeiter
Betriebsveranstaltungen, wie z.B. die Weihnachtsfeiert, bergen eine Menge juristischen Sprengstoff. Mitten drin im Getümmel finden sich immer wieder Streitigkeiten zu steuerrechtlichen Fragen, hier insbesondere die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer (siehe einen Reiter weiter unten).
Nach einer Gesetzesänderung zum 01.01.2015 hat das Bundesfinanzministerium mit Verwaltungsschreiben vom 14.10.2015 die Sichtweise der Finanzverwaltung klargestellt:
Die Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Beschäftigten im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind bis zum Freibetrag von 110 Euro lohnsteuer- und sozialabgabenfrei.
Wird der Betrag überschritten, dann unterfällt nach der neuen gesetzlichen Regelung nicht der gesamte Betrag, sondern nur der Betrag ab 110,01 Euro der Lohnsteuer und Sozialversicherung.
Für die Berechnung des Freibetrages sind auch solche Kosten zu berücksichtigen, die nicht einem Arbeitnehmer konkret zugerechnet werden können (z.B. die Kosten der Musikband oder der Eventagentur).
Der Bundesfinanzhof hatte dies ursprünglich anders entschieden, der Gesetzgeber hat dies aber danach dann so geregelt: Ab 01.01.2015 fallen auch diese Kosten in die Bemessungsgrundlage, d.h. die Kosten der Eventagentur usw. müssen auf die einzelnen Arbeitnehmer umgelegt werden.
Konkret heißt es dazu in Nr. 1 a in § 19 Abs. 1 Einkommensteuergesetz:
- (Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören…) Zuwendungen des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen anlässlich von Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter (Betriebsveranstaltung).
- Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet.
- Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 Euro je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, gehören sie nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, wenn die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht.
- Satz 3 gilt für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen jährlich. Die Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind abweichend von § 8 Absatz 2 mit den anteilig auf den Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen des Arbeitgebers im Sinne des Satzes 2 anzusetzen.
Der Freibetrag gilt also für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr.
Steuerpflichtige Zuwendungen können pauschal mit 25 % versteuert werden (§ 40 Absatz 2 EStG).
Bei mehr als 2 Betriebsveranstaltungen pro Teilnehmerkreis im Jahr kann der Arbeitgeber entscheiden, welche Betriebsveranstaltung er steuerfrei innerhalb des Freibetrags behandelt, und welche Betriebsveranstaltung er pauschal versteuert.
Die 50-Euro-Freigrenze (§ 8 Absatz 2 Satz 11 EStG) ist für Betriebsveranstaltungen nicht anwendbar.
Pauschalversteuerung auch, wenn nicht alle Arbeitnehmer teilnehmen können?
Der Bundesfinanzhof hat 2024 entschieden, dass die Pauschalversteuerung mit 25 % auch dann möglich ist, wenn lediglich Führungskräfte eingeladen werden, solange die Veranstaltung auf betrieblicher Ebene stattfindet und gesellschaftlichen Charakter hat.
Es kommt für die Pauschalversteuerung nicht darauf an, ob/dass die Betriebsveranstaltung allen Arbeitnehmer offensteht: Das ist nur notwendig, wenn der Arbeitgeber den Freibetrag von 110 Euro in Anspruch nehmen will.
Vermutlich gilt diese Entscheidung auch für andere Betriebsveranstaltungen, zu denen nur ein begrenzter Teil der Mitarbeiter eingeladen wird.
Umsatzsteuer
Die vorgenannten Grundsätze der Lohnsteuer gelten nicht bei der Umsatzsteuer, die das veranstaltende Unternehmen ggf. auf die Kosten abführen muss.
Der Bundesfinanzhof hatte mit einem Urteil aus 2023 die Verwaltungspraxis bestätigt:
- Bezieht der Unternehmer Leistungen für sogenannte Betriebsveranstaltungen (hier: Weihnachtsfeier), ist er nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn diese nicht ausschließlich dem privaten Bedarf der Betriebsangehörigen dienen, sondern durch die besonderen Umstände seiner wirtschaftlichen Tätigkeit bedingt sind.
- Der Vorsteuerabzug für sogenannte Aufmerksamkeiten (Freigrenze von 110 € je Arbeitnehmer und Kalenderjahr) richtet sich nach der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmers.
Das heißt:
Wenn 110 Euro pro teilnehmendem Arbeitnehmer nicht überschritten werden, ist ein Vorsteuerabzug für die Aufwendungen des Arbeitgebers möglich.
Bei Überschreiten des Betrags von 110 Euro besteht für den Arbeitgeber kein Anspruch auf Vorsteuerabzug.
Verträge mit anderen Beteiligten
Hier finden Sie Informationen zu Verträgen…
- mit Referenten und Moderatoren
- mit der Location
- mit einer Eventagentur
- mit Künstlern
- sonstige
Und weitere Informationen finden Sie in unseren Checklisten.
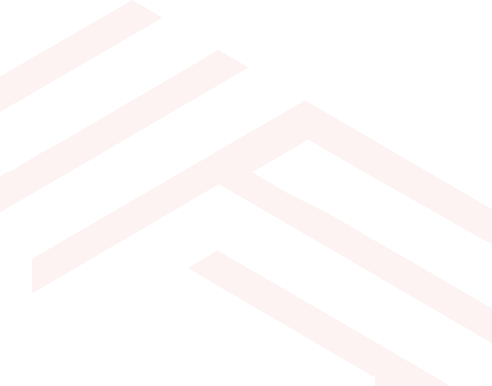

Rechtsberatung: Online oder telefonisch
Rechtsberatung vom Fachmann: Rechtsanwalt Thomas Waetke berät Veranstalter, Agenturen, technische Gewerke, Konzeptersteller, Genehmigungsbehörden, Vermieter von Locations usw. zu allen Fragen aus dem Eventrecht.
Weiterführende Links: