
Öffentlichkeit
Wann ist eine Veranstaltung öffentlich?
Welche Rechtsfolgen ergeben sich daraus?
Die „Öffentlichkeit“ spielt bei Veranstaltungen an verschiedenen Stellen eine Rolle:
- Muss GEMA-Gebühr bezahlt werden, wenn fremde Musik gespielt wird?
- Muss Künstlersozialabgabe bezahlt werden?
- Ist das Jugendschutzgesetz anwendbar?
- Ist das Gaststättenrecht anwendbar?
- Ist eine Genehmigung für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich?
Im Urheberrecht gibt es eine Definition in § 15 Absatz 3 UrhG, an der man sich orientieren kann:
„Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.“
Kurz:
- Kein abgrenzbarer Personenkreis sowie
- keine innere Verbundenheit.
Abgrenzbarkeit
Der Personenkreis ist bspw. dann nicht mehr abgrenzbar, wenn sich die Einladung an Jedermann richtet, d.h. jeder könnte teilnehmen, wenn er wollte. Ein Indiz ist dabei die Werbung im Internet: Wird Werbung im Internet, auf Plakaten o.ä. gemacht, dann spricht schon alleine das gegen die Abgrenzbarkeit.
Der Personenkreis wäre bspw. abgrenzbar, wenn bspw. nur Kunden anhand einer bestehenden Kundenliste, nur die Mitarbeiter, oder nur Freunde & Familie eingeladen würden.
Idee: Verein gründen?
Die Abgrenzbarkeit lässt sich nicht ohne weiteres durch eine Vereinsgründung herstellen, so dass vermeintlich nur die Mitglieder eingeladen werden: Ist der Verein auf Mitgliederzuwachs ausgelegt bzw. von Mitgliederwechseln geprägt, dann fehlt es auch an der Abgrenzbarkeit. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, spontan einen Verein zu gründen (ein Verein muss ja nicht zwingend im Vereinsregister eingetragen werden) und die Abgrenzbarkeit bspw. nur für 1 Veranstaltung zu behaupten, weil der Verein lediglich projektbezogen bzw. befristet gegründet sei. Das könnte vielleicht tatsächlich funktionieren, allerdings muss ja noch das zweite Kriterium, nämlich die innere Verbundenheit (siehe unten) erfüllt sein, an der es ggf. scheitern würde.
Und wenn 10 Freunde eine Party feiern, müssen sie ja nicht extra einen Verein gründen, da wir dann bereits eine Abgrenzbarkeit und innere Verbundenheit haben.
Wenn aber diese 10 Freunde einen Verein mit dem Ziel gründen, keine GEMA zahlen zu müssen, und dazu 100 Mitglieder aufnehmen, die dann zur Party eingeladen werden, muss man im Einzelfall prüfen, ob beide Voraussetzungen der Privatheit erfüllt sind.
Innere Verbundenheit
Bei der Frage nach der inneren Verbundenheit kommt es nicht darauf an, dass sich die Teilnehmer untereinander oder zum Veranstalter kennen oder bspw. über einen Arbeitsvertrag miteinander verbunden sind. Die Verbundenheit muss sich vielmehr auf der sozialen Ebene abspielen.
D.h.: Nur, weil man sich kennt, weil man Kunde ist oder weil man zusammen im selben Betrieb arbeitet, besteht noch lange keine innere Verbundenheit. Ganz grob kann man sich merken: Übersteigt die Teilnehmerzahl 100, wird es schwierig (nicht unmöglich) nachzuweisen, dass hier allseits eine innere Verbundenheit bestehen soll. Aber daran kann auch bereits bei 5 Personen scheitern!
Kriterien des BGH
Der Bundesgerichtshof hat zur Orientierung für Betriebsveranstaltungen einige klare Regeln aufgestellt:
- Eine Betriebsveranstaltung ist nicht deshalb privat, weil die Teilnehmer alle aus einem Betrieb stammen.
- Die Anbringung von Schildern bspw. mit dem Hinweis „Geschlossene Gesellschaft” spielt keine Rolle.
- Die Lebenserfahrung spricht bei einem großen Kreis von Betriebsangehörigen dagegen, dass ein vertrauterer persönlicher Kontakt zwischen den einzelnen Belegschaftsmitgliedern besteht.
- Das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das in der Regel zwischen den einzelnen Betriebsangehörigen während ihrer Zugehörigkeit zum gleichen Betrieb gegeben sein wird, sagt nichts darüber aus, ob die Betriebszugehörigkeit über die gleichgerichteten Arbeitsinteressen und die Werkverbundenheit hinaus zu einem so engen persönlichen Zusammenschluss der einzelnen Betriebsangehörigen untereinander führt, dass die Voraussetzung für Privatheit erfüllt wäre.
- Unentgeltlichkeit ist kein Indiz für Nicht-Öffentlichkeit.
- Wenn Familienangehörige, Verlobte oder Freunde der Betriebsangehörigen teilnehmen spricht dies für Öffentlichkeit (da es dann an dem Merkmal abgrenzbarerer Personenkreis fehlt).
Sonderfälle
Nr. 1a: Eine Betriebsveranstaltung ist oftmals auch öffentlich: Ob die eingeladenen Mitarbeiter untereinander oder zum Arbeitgeber innerlich verbunden sind, ist eine Frage des Einzelfalls.
Nr. 1b: Die Künstlersozialkasse lässt zu, dass auch bei öffentlichen Betriebsveranstaltungen (siehe Nr. 1) keine Abgabe anfällt, wenn zu der Betriebsveranstaltung keine Dritten (z.B. Anwohner, Kunden usw.) eingeladen werden, sondern nur Beschäftigte anwesend sind. Die GEMA macht diese Ausnahme übrigens nicht! D.h. wenn ein selbständiger Musiker gebucht wird, der gemapflichtige Musik spielt, muss ggf. keine Künstlersozialabgabe auf die Gage bezahlt werden, aber die kostenpflichtige Lizenz bei der GEMA.
Nr. 2: Eine geschlossene Veranstaltung kann auch öffentlich sein! Die „Geschlossenheit“ bedeutet ja nur, dass nicht Jedermann rein darf, bspw. weil über eine Gästeliste eingelassen wird. Aber wenn zuvor bereits im Internet an Jedermann gerichtet Werbung gemacht wurde, fehlt es bereits an der Abgrenzbarkeit.
Nr. 3: In der Versammlungsstättenverordnung spielt es keine Rolle, ob darin private oder öffentliche Veranstaltungen stattfinden. Ist die Anwendbarkeit der Verordnung einmal gegeben, ist sie quasi immer anzuwenden: Auch dann, wenn in ihr private Veranstaltungen stattfinden.
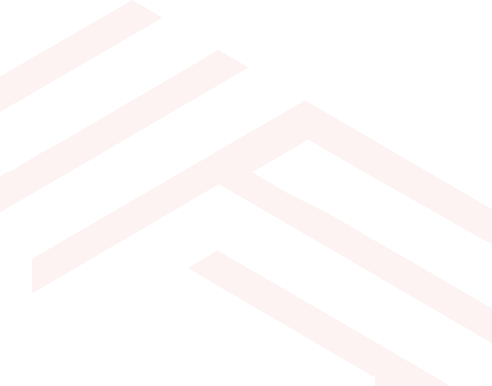

Rechtsberatung: Online oder telefonisch
Rechtsberatung vom Fachmann: Rechtsanwalt Thomas Waetke berät Veranstalter, Agenturen, technische Gewerke, Konzeptersteller, Genehmigungsbehörden, Vermieter von Locations usw. zu allen Fragen aus dem Eventrecht.
Weiterführende Links: